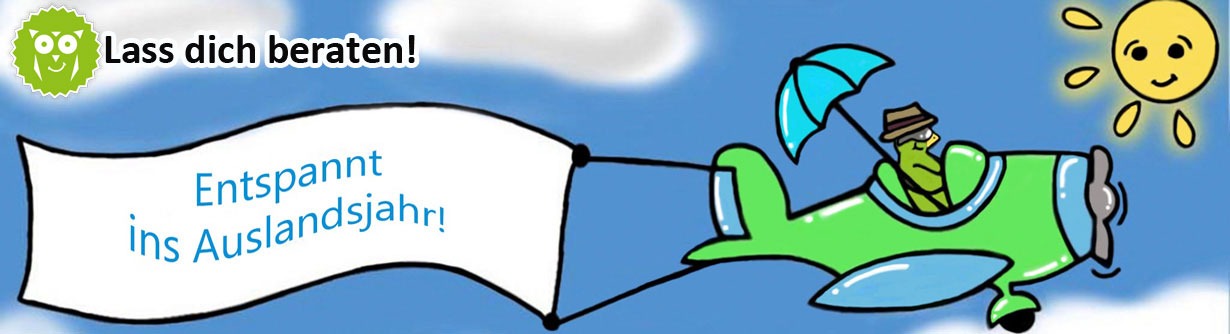4 Minuten Lesezeit
Kooperationen und Uni-Netzwerke als wertvolle Ressourcen für studentische Gründer
Das Studium ist für viele Gründer die Phase, in der Ideen entstehen. Zwischen Seminaren, Projekten und Diskussionen entwickeln sich dabei Gedanken, die mitunter zu echten Geschäftsideen heranreifen. Ein gutes Konzept allein reicht allerdings selten aus, um daraus ein funktionierendes Unternehmen zu machen. Stattdessen sind Netzwerke, Kooperationen und gemeinsames Lernen gefragt. Hochschulen bieten deshalb inzwischen zahlreiche Strukturen, die Studenten beim Aufbau eigener Projekte begleiten, von Gründungszentren über Fachschaften bis zu Alumni-Vereinen und regionalen Partnern.
Von der Idee zum Team
Viele Ideen bleiben auf Papier, weil die passenden Mitstreiter fehlen. Fachschaften, Studenteninitiativen und Projektgruppen sind jedoch ideale Orte, um Gleichgesinnte zu treffen. Hier entstehen Teams, gegenseitige Motivation und ein reger Austausch über Fachgrenzen hinweg.
Die Initiative zu übernehmen, liefert dabei wertvolle Erfahrungen darin, Verantwortung zu tragen und als eigener Chef Entscheidungen zu treffen. Häufig entwickelt sich aus einem Uniprojekt oder einer Wettbewerbsaufgabe zudem schon der erste Prototyp. Solche studentischen Kooperationsformate sind wertvoll, weil sie reale Zusammenarbeit ermöglichen und zeigen, wie ein Team funktioniert, wenn es auf Ergebnisse hinarbeitet.
Gründungszentren als Anlaufstelle
Fast jede größere Hochschule unterhält heute ein Gründungszentrum. Derartige Einrichtungen bieten Beratung und stellen Räume, Workshops sowie Kontakte zur Verfügung. Dort lernen Studenten, Geschäftsmodelle zu entwickeln, Finanzierung zu planen und ihre Idee überzeugend zu präsentieren. Häufig sind obendrein Experten aus der Wirtschaft beteiligt, die Feedback geben oder Mentorings übernehmen. Die regelmäßige Teilnahme an Veranstaltungen dieser Zentren führt dazu, dass Studenten automatisch ein Netzwerk aufbauen, das über die Studienzeit hinausgeht.
Ein besonderer Vorteil solcher Zentren ist der Zugang zu Wettbewerben und Förderprogrammen. Diese ermöglichen es, Projekte sichtbar zu machen und in kurzer Zeit viel zu lernen. Auch wenn eine Idee später angepasst oder verworfen wird, entsteht somit ein Verständnis dafür, wie unternehmerisches Denken funktioniert.
Eine Gründung im Laufe des Studiums gelingt übrigens am besten, wenn Projekte Schritt für Schritt geplant, Aufgaben priorisiert und organisatorische wie rechtliche Fragen frühzeitig geklärt werden. Diese Fähigkeiten helfen in jeder beruflichen Richtung weiter.
Förderungen und rechtliche Grundlagen
Sobald die Idee konkreter wird, kommen Themen wie Finanzierung und rechtliche Grundlagen ins Spiel. Viele Gründungszentren informieren daher über Zuschüsse, Stipendien oder Programme, die speziell für Studenten entwickelt wurden. Studenten, die ein kleines Gewerbe anmelden oder freiberuflich tätig sind, sollten zudem die steuerlichen und haftungsbezogenen Rahmenbedingungen kennen. Auch diese ausschlaggebenden Informationen werden in Gründungszentren vermittelt, sodass zum Beispiel steuerliche Vorteile durch Inanspruchnahme der Kleinunternehmerregelung genutzt werden.
Alumni und Partnerunternehmen als Brücke zur Praxis
Ehemalige Studenten sind typischerweise offen dafür, ihre Erfahrungen zu teilen. Viele Hochschulen fördern diesen Austausch gezielt durch Alumni-Treffen, Mentoring-Programme oder Netzwerkabende. Diese Veranstaltungen schaffen Gelegenheiten, Kontakte zu Personen zu knüpfen, die schon gegründet haben oder in spannenden Branchen tätig sind. Ein persönliches Gespräch mit jemandem, der den Weg bereits gegangen ist, vermittelt außerdem meist mehr als jeder theoretische Vortrag.
Auch Partnerunternehmen aus der Region sind ein wichtiger Teil des Ökosystems. Viele Hochschulen arbeiten eng mit Betrieben, Kammern und Gründerzentren zusammen. Dadurch entstehen Kooperationen, bei denen Studenten frühzeitig Einblicke in die Praxis gewinnen.
Lokale Hubs und Co-Working-Spaces
Neben den Angeboten auf dem Campus entstehen in vielen Städten Innovations- und Gründerhubs. Diese Orte verbinden Studenten mit Start-ups und Investoren. Die Atmosphäre ist offen, Ideen werden unkompliziert besprochen und Unterstützung findet sich häufig spontan. Durch regelmäßiges Arbeiten an diesen Orten erleben Studenten, wie andere auftretende Hürden angehen und sammeln dabei wertvolles Wissen im Austausch. In solchen Räumen entsteht obendrein die Gelegenheit, Projekte auszuprobieren, Feedback zu erhalten und erste Schritte zu gehen, um langfristig persönliche Träume zu verwirklichen.
Ein gemeinsames Arbeiten außerhalb der Hochschule schärft des Weiteren den Blick für reale Märkte. Wo an der Uni vieles noch theoretisch bleibt, bieten Co-Working-Spaces oder lokale Gründungsinitiativen unmittelbares Feedback von Personen, die bereits am Markt aktiv sind.
Praktische Schritte zum Aufbau deines Netzwerks
Damit der Start gelingt, helfen klare Strukturen und aktive Kontaktpflege. Dabei sollten Studenten
- Hochschulveranstaltungen gezielt nutzen, um Kontakte zu anderen Studenten und Lehrern aufzubauen
- an Workshops und Hackathons teilnehmen, um praktische Erfahrungen zu sammeln
- Kontakte zu Mentoren, Alumnis und Partnerunternehmen regelmäßig pflegen, nicht nur bei konkretem Bedarf
- den Austausch mit lokalen Gründerzentren und Co-Working-Spaces aktiv suchen
Kooperationen und Uni-Netzwerke öffnen Türen, die allein nur schwer zugänglich sind. Sie bieten zudem Zugang zu Wissen, Infrastruktur und Menschen, die ähnliche Ziele verfolgen.